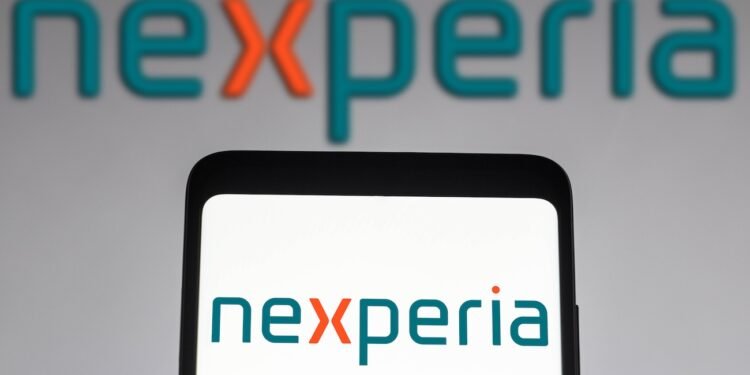Ein Hoffnungsschimmer im globalen Halbleiterstreit
Chipkrise – Die weltweite Chipkrise bekommt eine neue, politische Dimension. Nach Wochen diplomatischer Spannungen zwischen China und den Niederlanden hat Peking nun angedeutet, Ausnahmen beim Exportverbot für Halbleiter des niederländisch-chinesischen Unternehmens Nexperia zuzulassen. Diese Nachricht weckt Hoffnung – vor allem in der europäischen Automobilindustrie, die zunehmend unter den Lieferengpässen leidet. Doch trotz der Ankündigung bleiben viele Fragen offen.
Hintergrund: Ein niederländisches Unternehmen mit chinesischem Eigentümer
Nexperia ist in Europa kein unbekannter Name. Das Unternehmen mit Sitz in Nijmegen in den Niederlanden gehört seit 2019 zum chinesischen Technologiekonzern Wingtech Technology Co. Ltd. und gilt als einer der führenden Hersteller sogenannter diskreter Halbleiter – also vergleichsweise einfacher, aber essenzieller Bauteile, die in nahezu jedem elektronischen Gerät verbaut sind.
Diese Chips finden sich in Smartphones, Haushaltsgeräten, Industrieanlagen – und besonders in der Automobilindustrie, wo sie als unscheinbare, aber unentbehrliche Elemente in Steuergeräten, Airbags, Motorsteuerungen oder Klimaanlagen wirken. Ohne sie steht die Produktion still.
Laut internen Branchenangaben stammen rund 40 Prozent der weltweit eingesetzten Standardchips für Autos aus den Werken von Nexperia. Kein anderes Unternehmen in Europa spielt eine vergleichbar zentrale Rolle für die Versorgung der Fahrzeughersteller mit diesen Basisbauteilen.
Der niederländische Eingriff: Sicherheitsbedenken und politische Konsequenzen
Der aktuelle Konflikt entzündete sich Ende September 2025, als die niederländische Regierung überraschend entschied, Nexperia unter staatliche Kontrolle zu stellen. Begründet wurde der Schritt mit Sicherheitsbedenken: Die Regierung in Den Haag befürchtete, dass sensible Technologie in chinesische Hände geraten und militärisch genutzt werden könnte.
Der Schritt traf Peking ins Mark. Für China war die Entscheidung ein Eingriff in die Souveränität eines privatwirtschaftlichen Unternehmens – und damit ein Affront. Das chinesische Handelsministerium reagierte prompt und verhängte am 4. Oktober ein Exportverbot für Nexperia-Chips aus chinesischen Produktionsstätten.
Damit stand plötzlich die globale Lieferkette der Halbleiterindustrie unter Druck. Denn obwohl Nexperia in Europa ansässig ist, werden viele seiner Zwischenprodukte, darunter sogenannte Wafer, in China gefertigt oder dort weiterverarbeitet.
Ein Dominoeffekt in der globalen Lieferkette
Die Entscheidung aus Peking hatte unmittelbare Konsequenzen: Nexperia stoppte nach Informationen aus Unternehmenskreisen die Auslieferung bestimmter Zwischenprodukte, darunter auch Wafer aus chinesischen Montagewerken, an seine europäischen Standorte – insbesondere nach Hamburg, wo Teile der Fertigung für die Endmontage angesiedelt sind.
Diese Unterbrechung führte zu Engpässen in der europäischen Halbleiterproduktion. Mehrere Automobilhersteller und Zulieferer – darunter Volkswagen, BMW, Bosch und Stellantis – meldeten binnen weniger Tage erste Warnsignale.
„Wenn Nexperia-Chips nicht bald wieder verfügbar sind, drohen Produktionsstopps in Europa“, hieß es aus Branchenkreisen. Besonders die deutschen Autobauer seien betroffen, da sie in ihren Steuergeräten stark auf Standardchips aus Nexperia-Fertigung angewiesen sind.
China signalisiert Kompromissbereitschaft – Chipkrise
Nach wachsendem Druck aus Europa und den USA reagierte nun das chinesische Handelsministerium. In einer offiziellen Mitteilung ließ es wissen, man prüfe Ausnahmen vom Exportverbot für Unternehmen, die die entsprechenden Kriterien erfüllten.

Demnach könnten bestimmte Firmen – mutmaßlich solche, die eine unbedenkliche Verwendung der Chips nachweisen können – künftig wieder beliefert werden. Chinesische Behörden forderten betroffene Unternehmen auf, direkt Kontakt mit dem Ministerium aufzunehmen, um ihre Fälle prüfen zu lassen.
Damit deutet Peking zumindest eine Öffnung an. Gleichwohl bleibt unklar, welche konkreten Bedingungen erfüllt sein müssen, um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Offen ist auch, ob sich diese Ausnahmeregelung nur auf chinesische Firmen bezieht oder auch ausländische Kunden wie deutsche Automobilhersteller profitieren könnten.
Zwischen Symbolpolitik und Wirtschaftsdruck
Die Ankündigung Pekings ist mehr als eine wirtschaftliche Geste – sie ist ein Signal politischer Taktik. China befindet sich in einem komplexen Spannungsfeld zwischen geopolitischem Anspruch, nationaler Sicherheit und wirtschaftlicher Realität.
Während die Regierung in Peking ihre Technologiefirmen vor ausländischem Einfluss schützen möchte, ist sie zugleich auf internationale Märkte und Kooperationen angewiesen. Ein vollständiger Lieferstopp für Nexperia-Produkte würde nicht nur europäischen Autobauern schaden, sondern auch chinesischen Zulieferern und Joint Ventures, die eng mit westlichen Herstellern kooperieren.
Die chippolitische Rhetorik Chinas richtet sich daher gleichermaßen an die eigene Bevölkerung und an das Ausland. Indem Peking Ausnahmen in Aussicht stellt, kann es Verhandlungsbereitschaft signalisieren, ohne sein Gesicht zu verlieren.
Die niederländische Perspektive: Schutz oder Übergriff?
In den Niederlanden sieht man die Sache naturgemäß anders. Die Regierung in Den Haag verteidigt ihr Vorgehen als notwendige Schutzmaßnahme im Rahmen der nationalen Sicherheitsstrategie.
Man verweist auf das neue niederländische Sicherheitsgesetz für kritische Technologien, das ausländische Übernahmen und Einflussnahmen in sensiblen Branchen einschränken soll. Demnach könne der Staat eingreifen, wenn die Kontrolle über Unternehmen mit strategischer Bedeutung an Akteure übergeht, die als „nicht vertrauenswürdig“ gelten.
Im Fall Nexperia sah die Regierung offenbar Anzeichen für Missmanagement durch die chinesische Muttergesellschaft Wingtech. Zudem hätten interne Prüfer gewarnt, dass bestimmte Halbleitertechnologien möglicherweise militärisch relevant seien.
Das niederländische Eingreifen sei – so heißt es aus Regierungskreisen – keine Maßnahme gegen China, sondern eine Reaktion auf unternehmensinterne Probleme.
Pekings Reaktion: Schuldzuweisung und Druck
China reagierte empört. In Peking sprach das Handelsministerium von einer „unzulässigen Intervention“ der niederländischen Regierung und machte Den Haag für die Störungen in der globalen Lieferkette verantwortlich.
Chinas Handelsminister Wang Wentao soll die niederländische Entscheidung in einem Telefonat mit seinem Amtskollegen scharf kritisiert haben. Der Eingriff gefährde, so die Argumentation, die Stabilität internationaler Produktionsnetzwerke und schade letztlich auch europäischen Unternehmen.
China fordert von den Niederlanden eine schnelle Lösung – also die Rücknahme oder zumindest eine Abschwächung der staatlichen Kontrolle über Nexperia. Doch in Den Haag denkt man offenbar nicht daran, diese Forderung zu erfüllen.
Die Sicht der Industrie: Zwischen Sorge und Pragmatismus
Während die Politik mit harten Bandagen kämpft, wächst in der Wirtschaft die Sorge vor einem neuen Lieferkollaps. Noch sind die Erinnerungen an die Chipknappheit der Jahre 2021 und 2022 frisch, als infolge der Corona-Pandemie ganze Produktionslinien stillstanden.
Die Automobilindustrie reagiert nervös. Nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) könnten die Auswirkungen der Nexperia-Krise „in naher Zukunft zu erheblichen Produktionseinschränkungen führen“. Einige Hersteller haben bereits Krisenstäbe eingerichtet.
Bei Volkswagen etwa laufen tägliche Lageanalysen. Finanzvorstand Arno Antlitz erklärte intern, man müsse derzeit „von Woche zu Woche“ entscheiden, welche Modelle gebaut werden können. Auch BMW prüft laut Branchenkreisen alternative Zulieferer – was allerdings Wochen, wenn nicht Monate dauern könnte.
Bosch und Stellantis (der Mutterkonzern von Opel, Peugeot und Jeep) haben ebenfalls auf Engpässe hingewiesen. Der japanische Hersteller Nissan erklärte, seine Lagerbestände würden nur noch bis Anfang November reichen.
Der geopolitische Kontext: Der globale Wettlauf um Halbleiter
Die Nexperia-Krise ist kein isoliertes Ereignis, sondern Teil eines größeren geopolitischen Spiels um technologische Vorherrschaft. Halbleiter sind das Rückgrat der modernen Wirtschaft – und zugleich ein strategisches Machtinstrument.
Die USA, China, Europa, Japan und Südkorea investieren Milliarden, um eigene Chipindustrien aufzubauen oder zu schützen. Im Zentrum steht die Frage: Wer kontrolliert die Fertigung, wer die Technologie – und wer die Rohstoffe, etwa Seltene Erden?
China sieht sich seit Jahren unter Druck durch westliche Exportbeschränkungen, etwa beim Zugang zu hochentwickelten Lithografieanlagen oder Hochleistungschips. Die Entscheidung der Niederlande gegen Nexperia wird in Peking als weiterer Versuch interpretiert, Chinas technologische Entwicklung zu bremsen.
Umgekehrt wirft der Westen China vor, wirtschaftliche Abhängigkeiten als politisches Druckmittel zu nutzen – wie nun im Fall der blockierten Nexperia-Exporte.
Europa zwischen den Fronten – Chipkrise
Die Europäische Union steht in diesem Konflikt zwischen den Stühlen. Einerseits will sie sich nicht von China abhängig machen, andererseits ist sie auf chinesische Rohstoffe und Produktionskapazitäten angewiesen.
EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sprach zuletzt von „intensiven Gesprächen“ mit chinesischen Vertretern, um die Ausfuhrkontrollen zu entschärfen – allerdings bislang nur im Bereich der Seltenen Erden. Zum Fall Nexperia äußerte sich Brüssel bislang nicht konkret.
Insider gehen davon aus, dass die EU abwartet, wie sich die Lage zwischen Den Haag und Peking entwickelt. Hinter den Kulissen wird jedoch befürchtet, dass China künftig auch andere europäische Unternehmen mit ähnlichen Maßnahmen unter Druck setzen könnte.
USA und China: Eine neue Annäherung mit Hintertüren
Interessanterweise berichten US-Medien, dass Peking bereits erste Ausnahmegenehmigungen für den Export von Nexperia-Chips in die USA erwägt. Grundlage dafür sollen Vereinbarungen sein, die am Rande des APEC-Gipfels zwischen Xi Jinping und Donald Trump getroffen wurden.
Demnach könnte China den Export in die Vereinigten Staaten wieder zulassen, um im Gegenzug Lockerungen bei US-Exportbeschränkungen für High-End-Technologien zu erreichen. Sollten diese Berichte zutreffen, wäre Europa erneut der Verlierer im globalen Machtspiel – abhängig von Entscheidungen, die anderswo getroffen werden.
Chinas Kalkül: Kontrolle durch Flexibilität
Hinter der Ankündigung, Ausnahmen zu prüfen, steckt vermutlich eine strategische Berechnung. Peking nutzt das Exportverbot als politisches Druckmittel, um seine Position in den internationalen Handelsgesprächen zu stärken.
Indem China signalisiert, man könne Exporte im Einzelfall genehmigen, behält die Regierung die volle Kontrolle über den Prozess. Gleichzeitig können positive Entscheidungen als Zeichen guten Willens verkauft werden – sowohl gegenüber westlichen Partnern als auch gegenüber der eigenen Industrie.
Diese Taktik erlaubt Peking, wirtschaftliche Interessen und diplomatische Flexibilität miteinander zu verbinden. Für westliche Unternehmen bedeutet das jedoch weiterhin Unsicherheit: Niemand weiß, wann, wie und in welchem Umfang Ausnahmen tatsächlich gewährt werden.
Die Folgen für die deutsche Wirtschaft – Chipkrise
Für Deutschland ist der Fall Nexperia mehr als nur ein weiterer Punkt in der langen Liste internationaler Handelsstreitigkeiten. Die Bundesrepublik ist einer der größten Standorte für die Automobilproduktion weltweit – und damit extrem abhängig von stabilen Halbleiterlieferketten.
Sollten die Engpässe bei Nexperia länger anhalten, drohen nicht nur Produktionsausfälle, sondern auch massive wirtschaftliche Schäden entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Zulieferern über Logistikunternehmen bis hin zu Händlern.
Zudem wird deutlich, dass Europa bislang keine eigene, krisenfeste Halbleiterstrategie entwickelt hat. Zwar hat die EU mit dem sogenannten „European Chips Act“ ein milliardenschweres Förderprogramm aufgelegt, doch bis neue Fabriken in Dresden, Magdeburg oder Grenoble tatsächlich produzieren, werden Jahre vergehen.
Was jetzt auf dem Spiel steht – Chipkrise
Die Nexperia-Krise ist ein Lackmustest für die Resilienz der europäischen Industrie – und für die Fähigkeit der westlichen Staaten, ihre wirtschaftlichen Interessen gegen geopolitische Spannungen zu verteidigen.
Sollte China tatsächlich Ausnahmen zulassen, könnte das als diplomatischer Erfolg gewertet werden. Doch selbst dann bliebe die Abhängigkeit Europas von chinesischer Produktion bestehen. Jede politische Verstimmung könnte erneut zu einem Lieferstopp führen.
Für viele Beobachter ist klar: Der aktuelle Konflikt ist kein Einzelfall, sondern ein Vorgeschmack auf künftige Auseinandersetzungen im Zeitalter der technologischen Entkopplung.
Zwischen Entspannung und Unsicherheit – Chipkrise
Die Ankündigung Pekings, Ausnahmen beim Exportverbot für Nexperia-Chips zu prüfen, bringt kurzfristig Hoffnung – aber keine Entwarnung. Zu viele Fragen bleiben offen, zu viele Interessen prallen aufeinander.
Europa steht nun vor einer doppelten Aufgabe: kurzfristig die Versorgung der Industrie zu sichern – und langfristig die strategische Unabhängigkeit in der Halbleiterproduktion aufzubauen.
Die Chipkrise hat gezeigt, wie verletzlich hochentwickelte Volkswirtschaften sind, wenn sie in zentralen Zukunftstechnologien von anderen abhängig bleiben. Ob China seine Zusagen einhält oder erneut politisch taktiert, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Sicher ist nur eines: Der Konflikt um Nexperia ist mehr als ein Handelsstreit – er ist ein Symbol für den neuen Kalten Krieg um Mikrochips, Technologie und wirtschaftliche Macht.
Chipkrise: China stellt Ausnahmen bei Nexperia-Chips in Aussicht – Wir bleiben am Ball für Sie. BerlinMorgen.