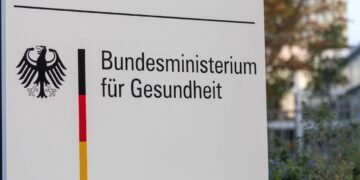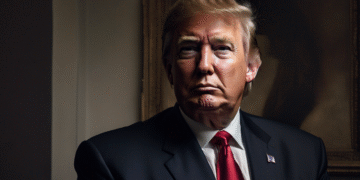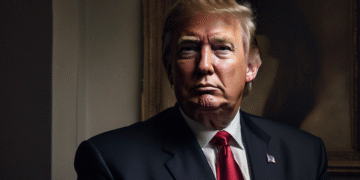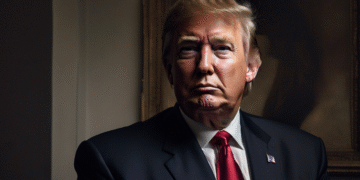Krankschreibung erst ab dem vierten Tag – Streit um Entlastung des Gesundheitssystems
Gesundheitssystem Entlastung – Zwischen Eigenverantwortung und Arbeitgeberinteressen: Warum der Vorstoß des Kassenärzte-Chefs Andreas Gassen eine Debatte über Vertrauen, Kontrolle und die Zukunft der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung entfacht hat.
Ein Vorstoß mit Sprengkraft – Gesundheitssystem Entlastung
Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat eine Reform ins Gespräch gebracht, die das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Ärzten grundlegend verändern könnte: Künftig sollen Beschäftigte erst ab dem vierten oder fünften Krankheitstag verpflichtet sein, eine Krankschreibung vorzulegen.
Was zunächst wie eine kleine administrative Anpassung klingt, ist in Wahrheit ein Vorschlag mit erheblicher Tragweite – sowohl für die tägliche Praxis in Arztpraxen als auch für das Vertrauen in die Selbstverantwortung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Gassen begründet seine Forderung mit einem klaren Ziel: Das überlastete Gesundheitssystem soll von unnötigen Arztbesuchen entlastet werden. Denn jedes Jahr, so der KBV-Chef, werden Millionen Menschen allein deshalb vorstellig, um sich für ein oder zwei Krankheitstage eine ärztliche Bescheinigung ausstellen zu lassen – obwohl eine Selbstbehandlung zu Hause oft ausreichen würde.
Die aktuelle Regelung – ein System mit Lücken – Gesundheitssystem Entlastung
Nach der derzeitigen gesetzlichen Lage müssen Beschäftigte spätestens ab dem vierten Krankheitstag ein ärztliches Attest vorlegen. Im Entgeltfortzahlungsgesetz (§ 5 EFZG) ist aber festgelegt, dass Arbeitgeber das Recht haben, bereits früher eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu verlangen – also schon nach einem oder zwei Tagen.
Diese Klausel wurde ursprünglich eingeführt, um Missbrauch vorzubeugen. In der Praxis jedoch, so Gassen, führe sie zu einem unnötigen Aufwand: Millionen von Menschen würden aus rein formalen Gründen in die Arztpraxen gedrängt, nur um ein Stück Papier zu bekommen, das in vielen Fällen keinen medizinischen Mehrwert habe.
Er fordert deshalb, diese Ausnahmeregelung zu streichen. Nur so könne die ärztliche Bescheinigung wieder den Stellenwert eines echten medizinischen Attestes erhalten – statt zu einer bloßen Formalität im Bürokratie-Dschungel zu verkommen.
116 Millionen Krankschreibungen pro Jahr – ein gigantischer Aufwand
Die Zahlen sprechen für sich: Laut der KBV werden in Deutschland jährlich rund 116 Millionen Krankschreibungen ausgestellt.

Etwa 35 Prozent davon betreffen Krankheiten, die höchstens drei Tage dauern.
Das bedeutet: Über 40 Millionen Arzttermine pro Jahr dienen im Kern nur der Ausstellung einer Bescheinigung.
Diese Praxis kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld:
Gassen rechnet vor, dass bei Wegfall dieser Kurzzeit-Krankschreibungen 1,4 Millionen Arbeitsstunden in Arztpraxen eingespart werden könnten – was einer finanziellen Entlastung von rund 100 Millionen Euro entspräche.
Gleichzeitig könnten Ärztinnen und Ärzte die freiwerdenden Kapazitäten nutzen, um sich intensiver um chronisch Kranke oder akute Fälle zu kümmern.
Eigenverantwortung statt Arztbesuch – Gesundheitssystem Entlastung
Kern des Vorschlags ist die Idee einer „Karenzzeit der Selbstverantwortung“.
Gassen will Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zutrauen, selbst einschätzen zu können, ob sie arbeitsfähig sind oder nicht – zumindest für einige Tage.
Das Konzept erinnert an Modelle, wie sie in anderen europäischen Ländern längst erfolgreich etabliert sind.
In Großbritannien etwa dürfen sich Beschäftigte bis zu sieben Tage selbst krankmelden („self-certification“).
Auch in Skandinavien gilt ein vergleichsweise großzügiger Umgang mit kurzfristigen Krankheitsausfällen.
Das deutsche System hingegen gilt als besonders bürokratisch und misstrauisch – ein Relikt aus einer Zeit, in der Kontrolle wichtiger war als Vertrauen.
Gassen argumentiert, dass die Gesellschaft längst reifer geworden sei:
„Wir sprechen von mündigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“, so seine Haltung.
Wer nach zwei Tagen mit Fieber oder Magen-Darm-Grippe wieder fit sei, müsse nicht zwingend eine Arztpraxis aufsuchen – zumal die Ansteckungsgefahr in Wartezimmern das Problem oft noch verschärfe.
Kritik von Arbeitgeberseite: „Ein falsches Signal“
Kaum war der Vorschlag öffentlich, kam Widerstand – vor allem von den Arbeitgeberverbänden.
Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, nannte die Idee eine „zusätzliche Belastung für Arbeitgeber“.
Eine pauschale Verlängerung der Frist zur Vorlage der Krankschreibung löse keine strukturellen Probleme, sondern öffne Missbrauch Tür und Tor.
Aus Sicht der Arbeitgeber könnte die Reform dazu führen, dass Fehlzeiten steigen – nicht, weil mehr Menschen krank wären, sondern weil eine fehlende Kontrollinstanz den Anreiz zum Blaumachen vergrößere.
Gesundheitssystem Entlastung – Gerade in Branchen mit hoher körperlicher Belastung oder unregelmäßigen Arbeitszeiten sei das Risiko groß, dass die Eigenverantwortung überstrapaziert werde.
Kampeter forderte stattdessen eine gezieltere Patientensteuerung und eine bessere Nutzung digitaler Angebote, um das Gesundheitssystem zu entlasten, statt pauschale Änderungen vorzunehmen.
Er sieht die Ärzteschaft in der Pflicht, konstruktiv an Kostensenkungen mitzuwirken, statt – wie er es formuliert – „mit Nebelkerzen von den eigentlichen Problemen abzulenken“.
Eine Debatte zwischen Vertrauen und Kontrolle – Gesundheitssystem Entlastung
Der Konflikt berührt einen zentralen Punkt des deutschen Arbeitslebens: das Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Während Gassen auf Eigenverantwortung und Mündigkeit setzt, pochen viele Arbeitgeber auf Kontrolle und Nachweis.
Beide Perspektiven haben ihre Berechtigung – doch sie stehen sich diametral gegenüber.
In Deutschland ist die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht nur medizinisches Dokument, sondern auch arbeitsrechtliches Instrument.
Sie entscheidet über Lohnfortzahlung, Versicherungsansprüche und Personalplanung.
Eine spätere Vorlage könnte in Betrieben mit knapper Personaldecke, etwa in Pflege, Gastronomie oder Produktion, zu erheblichen Planungsproblemen führen.
Kritiker befürchten zudem, dass sich durch die neue Regelung mehr Kurzzeitausfälle häufen könnten – was besonders kleine Betriebe stark träfe.
Die digitale Krankschreibung – ein Schritt zur Entbürokratisierung
Parallel zu dieser Debatte befindet sich das System der Krankschreibungen ohnehin im Wandel.
Mit der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) seit 2023 ist der bürokratische Aufwand bereits deutlich gesunken:
Ärzte übermitteln die Daten direkt an die Krankenkassen, Arbeitgeber können sie digital abrufen.
Doch die Praxis zeigt: Auch das digitale System hat seine Tücken.
Gerade in den ersten Monaten kam es zu technischen Problemen, fehlerhaften Übertragungen und zeitlichen Verzögerungen.
Viele Hausärzte klagten über zusätzliche Bürokratie, statt über Entlastung.
Eine spätere Pflicht zur Krankschreibung könnte die Digitalisierung sinnvoll ergänzen – indem sie die Anzahl der Fälle verringert, die überhaupt elektronisch verarbeitet werden müssen.
Ökonomische und gesellschaftliche Dimensionen – Gesundheitssystem Entlastung
Jenseits der Bürokratiefrage hat der Vorstoß von Gassen eine gesellschaftliche Signalwirkung.
Er stellt die Frage, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland tatsächlich noch das Vertrauen genießen, ehrlich mit Krankheit umzugehen.
Gleichzeitig geht es um Geld:
Jede ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zieht Kosten nach sich – für die Krankenkassen, für die Arztpraxen und indirekt auch für die Wirtschaft.
Ein Rückgang von nur wenigen Prozentpunkten könnte jährlich mehrstellige Millionenbeträge einsparen.
Allerdings:
Ein höheres Maß an Eigenverantwortung könnte auch zu Risiken führen.
Wer aus Angst, als „Drückeberger“ zu gelten, länger krank arbeitet, riskiert nicht nur seine eigene Gesundheit, sondern auch die Ansteckung anderer.
Eine gesunde Balance zwischen Vertrauen und Vorsicht ist also entscheidend.
Erfahrungen aus anderen Ländern – Gesundheitssystem Entlastung
Ein Blick nach Europa zeigt, dass Deutschland mit seiner strengen Regelung eher ein Sonderfall ist.
In Schweden etwa reicht bei einer Krankheitsdauer von bis zu sieben Tagen eine Selbsterklärung aus; erst danach ist ein ärztliches Attest nötig.
In Finnland gilt eine ähnliche Regelung, wobei einige Arbeitgeber individuelle Vereinbarungen treffen können.
In Frankreich wiederum ist das System stärker ärztlich geprägt, aber durch digitale Lösungen und eine enge Verzahnung von Krankenkassen und Betrieben effizienter gestaltet.
Internationale Studien deuten darauf hin, dass eine spätere Krankschreibung nicht automatisch zu mehr Missbrauch führt – wohl aber zu weniger Bürokratie und mehr Zufriedenheit bei Beschäftigten.
Die Fehlzeiten unterscheiden sich langfristig kaum, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber stimmt.
Politische Reaktionen – Schweigen mit Signalcharakter
Aus der Politik kamen bislang zurückhaltende Reaktionen.
Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die Forderung der KBV nicht kommentiert, unterstützt aber laut Arbeitgeberverbänden das Ziel, die Gesundheitsausgaben zu senken.
Ob die Verlängerung der Frist dabei ein geeignetes Instrument ist, bleibt offen.
In Koalitionskreisen wird das Thema mit Vorsicht behandelt:
Während Teile der FDP dem Gedanken der Selbstverantwortung grundsätzlich positiv gegenüberstehen, warnen Vertreter der SPD und der Gewerkschaften vor einer möglichen Aushöhlung des Arbeitnehmerschutzes.
Zwischen Arzt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer – ein Dreiecksverhältnis im Wandel
Die Diskussion zeigt, dass die Krankschreibung weit mehr ist als nur ein Zettel:
Sie steht symbolisch für das Verhältnis von Vertrauen, Kontrolle und Verantwortung in der Arbeitswelt.
Für die Ärzteschaft bedeutet Gassens Vorschlag die Chance, sich wieder stärker auf die eigentliche medizinische Aufgabe zu konzentrieren.
Für Arbeitgeber bedeutet er einen möglichen Kontrollverlust.
Und für Arbeitnehmer könnte er ein Zeichen von Respekt und Selbstbestimmung sein – vorausgesetzt, das Vertrauen wird nicht missbraucht.
Ein Balanceakt mit Folgen – Gesundheitssystem Entlastung
Der Vorschlag, Krankschreibungen erst ab dem vierten oder fünften Tag vorzusehen, ist mehr als eine technische Reformidee – er ist ein gesellschaftlicher Stresstest.
Er zwingt dazu, über Vertrauen, Verantwortung und die Kultur der Arbeit in Deutschland nachzudenken.
Das Ziel, das Gesundheitssystem zu entlasten, ist unbestritten richtig.
Doch die Umsetzung muss sensibel erfolgen, um nicht neue Ungerechtigkeiten zu schaffen oder den Zusammenhalt in Betrieben zu gefährden.
Vielleicht ist Gassens Idee der richtige Impuls zur richtigen Zeit – vorausgesetzt, sie wird nicht als Misstrauensvotum gegen Arbeitnehmer oder Arbeitgeber verstanden, sondern als Einladung zu mehr Eigenverantwortung und weniger Bürokratie.
Denn am Ende geht es nicht nur um Atteste, sondern um das Fundament jeder funktionierenden Gesellschaft: Vertrauen.
Gesundheitssystem Entlastung – Wir bleiben am Ball für Sie. BerlinMorgen.
Quellen. Tagesschau, Redaktionsnetzwerk Deutschland
Foto Bundesgesundheitsministerin Nina Warken – © Jan Pauls