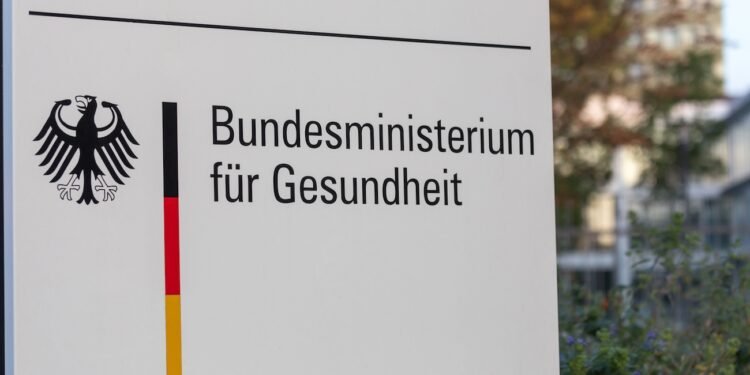Elektronische Patientenakte: Großes Versprechen, kleiner Nutzen
Elektronische Patientenakte – Warum das Vorzeigeprojekt der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu scheitern droht
Viel Lärm um wenig Nutzung
Seit Jahren wird sie angekündigt, seit April 2025 ist sie bundesweit verpflichtend verfügbar: die elektronische Patientenakte (ePA).
Ein digitales Gesundheitsdossier, das Behandlungen, Diagnosen, Laborwerte und Medikationen bündelt und für Ärzte wie Patienten jederzeit abrufbar macht.
Ein Meilenstein sollte es sein – für Transparenz, Effizienz und Patientenautonomie.
Doch nur wenige Monate nach der flächendeckenden Einführung fällt die Bilanz ernüchternd aus.
Trotz Millionen angelegter Akten nutzen bislang nur Bruchteile der Versicherten die ePA aktiv. Der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Markus Beier, spricht bereits von einer drohenden „Bruchlandung“.
Schwarzer Peter für die Krankenkassen
Beier sieht die Verantwortung für das schleppende Rollout nicht bei den Ärzten, sondern klar bei den Krankenkassen.
Insbesondere kritisiert er die mangelnde Aufklärung: Statt aktive Unterstützung gebe es lediglich allgemeine Informationsbriefe, kaum persönliche Ansprache, kaum Hilfestellung.
Dabei könnten die Kassen laut Beier ihre üppigen Verwaltungsetats besser einsetzen – etwa für konkrete Begleitung bei der Einrichtung oder Schulung der Versicherten.
Registrierung: ein digitaler Hindernislauf
Die Gründe für das geringe Interesse sind schnell ausgemacht:
Wer seine ePA erstmalig nutzen will, muss sich umständlich registrieren, die App installieren, sich identifizieren – und das Ganze über eine Technik, die regelmäßig Aussetzer hat.
Patienten berichten von Fehlermeldungen, langen Wartezeiten bei der Identitätsprüfung und fehlenden Anleitungen.

Auch in Arztpraxen ist die Stimmung gereizt.
Es vergeht kaum eine Woche, in der die Praxisteams nicht mit Zugriffsproblemen kämpfen müssen.
Die Folge: genervte Patienten, gestresste Mitarbeiter und kaum Vertrauen in die neue Technik.
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache
Ein Blick in die Statistiken verdeutlicht die Dimension der Nutzungslücke:
- Techniker Krankenkasse (TK): 11 Millionen ePAs angelegt, aber nur 750.000 aktive Nutzer
- Barmer: 7,8 Millionen ePAs – 250.000 werden regelmäßig genutzt
- AOK (11 Kassen): 25,8 Millionen ePAs – aber nur 200.000 Versicherte haben eine persönliche Gesundheits-ID angelegt
Fazit: Weniger als 5 % der Versicherten interagieren aktiv mit ihrer Akte.
Die meisten wissen offenbar nicht einmal, dass sie existiert – oder wie sie funktioniert.
Was die ePA eigentlich leisten könnte
Dabei ist das Konzept überzeugend – auf dem Papier. Die elektronische Patientenakte soll alle Gesundheitsdaten eines Menschen zentral speichern: Impfungen, OP-Berichte, MRT-Bilder, Medikationspläne.
Mit dem Einverständnis der Patient:innen könnten diese Daten behandelnden Ärzten, Kliniken oder Apotheken zugänglich gemacht werden. Notfallinformationen, chronische Erkrankungen oder Wechselwirkungen von Medikamenten – all das wäre auf einen Blick verfügbar.
Ziel ist es, Doppeluntersuchungen zu vermeiden, Risiken zu minimieren und die Versorgung effizienter zu gestalten. Doch zwischen Vision und Wirklichkeit klafft eine digitale Lücke.
Ein Reformprojekt mit zu langer Vorgeschichte – Elektronische Patientenakte
Die Idee der ePA ist nicht neu: Schon vor über 20 Jahren wurde sie in politischen Strategiepapieren angekündigt.
Seit 2021 war sie auf freiwilliger Basis nutzbar, doch erst mit der gesetzlichen Verpflichtung 2025 kam bundesweit Bewegung ins Spiel – oder zumindest in die Zahlen.
Denn: Viele ePAs wurden automatisch erstellt, ohne aktives Zutun der Versicherten.
Das Grundproblem ist jedoch nicht allein technischer Natur – sondern ein Vertrauensproblem.
Patienten fragen sich:
Wer kann meine Daten sehen? Wie sicher sind sie gespeichert? Was passiert im Ernstfall – oder bei einem Hackerangriff?
Der Patient muss ins Zentrum – nicht die Technik – Elektronische Patientenakte
Die ePA ist mehr als ein Softwareprodukt – sie ist ein kultureller Wandel im Gesundheitswesen.
Damit sie funktioniert, braucht es mehr als Verordnungen und Apps:
- Patienten müssen verstehen, was sie davon haben.
- Krankenkassen müssen aktiv aufklären und unterstützen.
- Die Technik muss einfach, zuverlässig und alltagstauglich sein.
- Ärzte und Praxisteams brauchen stabile Systeme und Fortbildungen.
Die digitale Patientenakte kann das Rückgrat einer modernen Gesundheitsversorgung werden – wenn sie ernst genommen wird.
Andernfalls droht ein weiterer kostspieliger Flop der deutschen Digitalpolitik.
Die Zeit, das Steuer herumzureißen, läuft. Doch noch ist es nicht zu spät.
Elektronische Patientenakte – Wir bleiben am Ball für Sie. BerlinMorgen.
Quellen Rheinische Post, Barmer