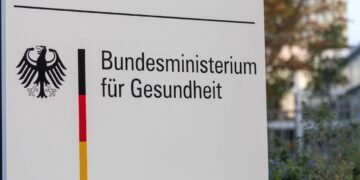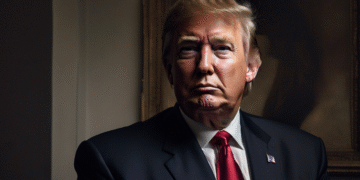Stahlgipfel im Kanzleramt: Hoffnungsträger oder letztes Aufgebot?
Die deutsche Stahlindustrie steht unter Druck – der „Stahlgipfel“ im Kanzleramt soll Lösungen bringen. Doch kann ein Treffen von weniger als zwei Stunden eine jahrzehntelange Krise aufhalten?
Stahlgipfel im Kanzleramt – Es ist Mittag in Berlin, als sich im Kanzleramt eine Runde versammelt, deren Zusammensetzung signalisiert: Es geht um viel. Vertreter der Bundesregierung, Ministerpräsidenten stahlstarker Bundesländer, Spitzenvertreter von Industrieverbänden, Gewerkschafter und Konzernchefs treffen sich auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum sogenannten Stahlgipfel. Die Agenda ist klar: Es soll darum gehen, wie die deutsche Stahlindustrie überleben kann – wirtschaftlich, politisch und ökologisch.
Eine Branche im Umbruch – und unter Druck
Seit Jahrzehnten kämpft die Stahlindustrie mit sich wandelnden globalen Rahmenbedingungen. Einst Rückgrat der deutschen Industrie, droht dem Sektor heute das Abgleiten in die Bedeutungslosigkeit – sofern nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. Rund 80.000 Menschen arbeiten laut Angaben der Wirtschaftsvereinigung Stahl noch in der Branche – viele davon in Nordrhein-Westfalen, dem Saarland oder Bremen. Es geht also nicht nur um eine Branche, sondern auch um ganze Regionen.
Die Probleme sind vielschichtig: Hohe Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produzenten im internationalen Vergleich. Gleichzeitig drücken billige Importe – insbesondere aus China – auf die Preise. Dazu kommen strukturelle Nachfrageschwächen, vor allem durch die konjunkturelle Abkühlung in der Automobilindustrie. Und schließlich lastet auf der Branche auch der politisch gewollte Umbau zu einer klimafreundlichen Produktion – Stichwort „grüner Stahl“.
Industriestrompreis als Rettungsanker?
Ein zentraler Punkt der aktuellen Diskussion ist der sogenannte Industriestrompreis. Die energieintensive Stahlbranche hofft auf staatlich verbilligte Strompreise, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hatte dazu bereits angekündigt, dass die Gespräche mit der EU-Kommission kurz vor dem Abschluss stünden. Ein subventionierter Strompreis ab 2026 gilt nun als realistisch. Doch die Details bleiben unklar – und der Zeitdruck wächst.
Ein Industriestrompreis könnte ein entscheidender Hebel sein, um Produktionsverlagerungen ins Ausland zu verhindern. Kritiker hingegen warnen vor Marktverzerrungen und langfristigen Subventionsabhängigkeiten. Zudem ist offen, wie der Staat die Entlastungen finanzieren will – und ob die EU-Kommission diesen Schritt im Sinne des Beihilferechts zulässt.
Zwischen Zollschutz und Welthandel – Stahlgipfel im Kanzleramt
Neben dem Energiepreis ist der internationale Handel mit Stahl ein weiterer Konfliktpunkt. Die EU-Kommission prüft derzeit umfassende Schutzzölle gegen Billigimporte, insbesondere aus China. Sechs deutsche Bundesländer haben sich in einem gemeinsamen Positionspapier bereits für einen Strafzoll von mindestens 50 Prozent ausgesprochen – in Anlehnung an das US-Vorbild. Die Bundesregierung zögert hingegen noch, sich eindeutig zu positionieren.

Die Argumente liegen auf dem Tisch: Auf der einen Seite stehen die Produzenten, die sich gegen Dumpingpreise aus Fernost kaum noch zur Wehr setzen können. Auf der anderen Seite sehen Abnehmerindustrien – etwa der Verband der Automobilindustrie – in der Einführung hoher Zölle eine Bedrohung für ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit. Höhere Einkaufspreise könnten sich auf Endprodukte und Verbraucherpreise auswirken.
Die Rolle Chinas – Partner und Konkurrent zugleich
China spielt in der Diskussion eine doppelte Rolle. Als größter Stahlproduzent der Welt überflutet das Land regelmäßig die Weltmärkte mit preisgünstigem Material. Gleichzeitig ist China aber auch ein wichtiger Exportmarkt für deutsche Industriegüter – insbesondere für Maschinenbau, Chemie und Automotive. Eine Verschärfung des Handelskonflikts birgt also erhebliche Risiken für deutsche Unternehmen.
Diese Ambivalenz zeigt sich auch in der politischen Agenda: Während Außenminister Johann Wadephul (CDU) jüngst eine geplante Chinareise absagte, kündigte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) noch für diesen Monat einen Besuch in Peking an. In seinen Gesprächen will er auch die Interessen der deutschen Industrie vertreten – unter anderem mit der Forderung, europäischen Stahl bei öffentlichen Vergaben systematisch zu bevorzugen.
Der grüne Stahl – einst Hoffnung, heute Nebenschauplatz?
Bemerkenswert am aktuellen Stahlgipfel ist, dass das Thema „grüner Stahl“ deutlich weniger präsent ist als noch vor wenigen Jahren. Der Begriff stand einst für die Transformation der Branche: Weg von der kohlenstoffbasierten Hochofenroute, hin zur wasserstoffbasierten Direktreduktion. Doch die Investitionen dafür sind enorm – und das wirtschaftliche Umfeld aktuell kaum geeignet, um derartige Innovationsprojekte ohne massive staatliche Unterstützung zu stemmen.
Wirtschaftlich betrachtet, ist „grüner Stahl“ bislang eher ein Konzept als ein Marktprodukt. Die Nachfrage ist gering, die Herstellungskosten hoch, die Infrastruktur unzureichend. Zwar gibt es Pilotprojekte, doch ein Durchbruch ist nicht in Sicht. Auch deshalb tritt die Bundesregierung bei diesem Thema derzeit merklich auf die Bremse – zumindest kommunikativ.
Stahlgipfel im Kanzleramt – Symbolpolitik oder Strategie?
Die große Frage ist: Was bringt der Gipfel wirklich? Ist das Treffen im Kanzleramt ein ernsthafter Versuch, Lösungen zu erarbeiten – oder lediglich Symbolpolitik in Zeiten wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit?
Die Bundesregierung selbst spricht von einem „Wegbereitungsgipfel“. Es gehe darum, gemeinsame Zielbilder zu entwickeln und nächste Schritte zu definieren. Doch die Zeit drängt. Die wirtschaftliche Situation der Branche ist angespannt wie selten. Ohne schnelle Entscheidungen könnte es bald zu Werkschließungen kommen – mit dramatischen Folgen für Beschäftigte, Kommunen und ganze Regionen.
Forderungen der Beteiligten – eine Übersicht
Gewerkschaften (IG Metall, Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie):
- Sofortige Einführung eines Industriestrompreises
- Langfristige Standortgarantien für Werke
- Staatliche Investitionen in grüne Produktionsmethoden
- Schutz vor unfairem Wettbewerb durch Importe
Bundesländer mit stahlintensiver Industrie (NRW, Saarland, Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg):
- Einführung wirksamer EU-Schutzzölle
- Bevorzugung europäischen Stahls bei öffentlichen Aufträgen
- Strukturhilfen für Transformationsprozesse
Industrieverbände und Konzerne:
- Planungssicherheit durch klare staatliche Rahmensetzung
- Abschaffung übermäßiger Bürokratie bei Genehmigungen
- Technologieförderung für Dekarbonisierung
Bundesregierung:
- Industriestrompreis ab 2026 (in Vorbereitung)
- Offenheit für Schutzinstrumente auf EU-Ebene
- Prüfung gezielter Investitionsanreize
Rückblick: Der Stahlgipfel 2024 – viele Worte, wenig Wirkung
Der Stahlgipfel im Dezember 2024 hatte große Erwartungen geweckt, aber nur begrenzte Resultate geliefert. Zwar einigte man sich damals auf die Relevanz der Branche – doch konkrete Maßnahmen blieben aus. Viele Beteiligte hoffen nun, dass sich dieses Muster nicht wiederholt.
Ein wesentlicher Unterschied: Die wirtschaftliche Lage hat sich seither weiter verschlechtert. Der Absatz stagniert, die Investitionsbereitschaft sinkt. Gleichzeitig steigen die geopolitischen Risiken – von gestörten Lieferketten bis hin zur Unsicherheit bei internationalen Handelsabkommen. Der Stahlgipfel 2025 hat somit eine Brisanz, die weit über die Branche hinausreicht.
Eine unterschätzte Branche mit Systemrelevanz
Die Bedeutung der Stahlindustrie wird im politischen Diskurs häufig unterschätzt. Dabei ist Stahl ein Grundstoff – unverzichtbar für Bau, Mobilität, Maschinenbau und Energieinfrastruktur. Ohne heimische Stahlproduktion steigt die Abhängigkeit von Importen – mit allen Risiken, die geopolitische Instabilitäten mit sich bringen.
Besonders sicherheitsrelevante Bereiche wie die Rüstungsindustrie oder der Infrastrukturausbau sind auf eine stabile Versorgung mit Qualitätsstahl angewiesen. Ein Kollaps der Branche hätte daher weitreichende Folgen – wirtschaftlich, sozial und sicherheitspolitisch.
Ausblick: Ein Plan für die nächsten 12 Monate?
Was bleibt vom heutigen Gipfel? Die Beteiligten setzen auf eine Art „Stahlpakt“ – eine Kombination aus kurz- und mittelfristigen Maßnahmen, die gemeinsam mit der EU abgestimmt werden sollen. Erste Punkte eines möglichen Maßnahmenplans zeichnen sich ab:
Kurzfristig (bis Ende 2025):
- Einführung eines Industriestrompreises (Ziel: 1.1.2026)
- Übergangsregelungen für besonders betroffene Werke
- Verstärkte Marktüberwachung bei Importen
- Prüfung von Schutzzöllen durch die EU-Kommission
Mittelfristig (2026–2027):
- Aufbau von Infrastruktur für Wasserstoff-basierte Produktion
- Anreizprogramme für klimafreundliche Produktionsprozesse
- Digitalisierung von Produktionsprozessen
- Anpassung öffentlicher Ausschreibungen zugunsten von EU-Stahl
Ob diese Pläne Realität werden, hängt maßgeblich vom politischen Willen der Bundesregierung – und vom Rückhalt in der EU – ab.
Stahl als Prüfstein für Industriepolitik – Stahlgipfel im Kanzleramt
Der Stahlgipfel 2025 könnte sich als Wendepunkt erweisen – oder als weiteres Kapitel in einer langen Geschichte vertaner Chancen. Fest steht: Die Herausforderungen sind enorm, die Interessenkonflikte vielfältig. Doch die deutsche Industriepolitik wird sich daran messen lassen müssen, ob sie in der Lage ist, zentrale Wertschöpfungsketten im Land zu halten und zugleich den Wandel zu einer klimaneutralen Zukunft aktiv zu gestalten.
Stahl ist dabei mehr als ein Werkstoff. Er steht sinnbildlich für die Frage, ob Deutschland in der Lage ist, industrielle Transformation sozial verträglich, ökonomisch tragfähig und ökologisch verantwortlich zu gestalten. Die Antwort darauf beginnt – vielleicht – heute im Kanzleramt.
Stahlgipfel im Kanzleramt – Wir bleiben am Ball für Sie. BerlinMorgen.