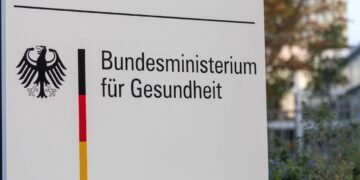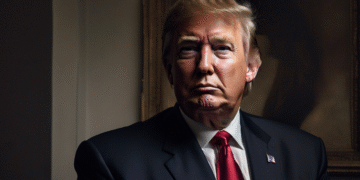Deutschlands Wirtschaft auf wackeligen Beinen – Warum ohne Reformen kein nachhaltiger Aufschwung gelingt
Ein schwaches Signal nach zwei Krisenjahren
Mageres Wirtschaftswachstum – Die deutsche Wirtschaft hat zwei Jahre der Rezession hinter sich und blickt nun mit vorsichtigem Optimismus nach vorn.
Für 2025 rechnen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute mit einem minimalen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent.
Dieses Wachstum gilt als mageres Signal, das zwar eine Abkehr von der Stagnation markiert, jedoch noch weit von einer echten Erholung entfernt ist. Erst für 2026 und 2027 erwarten die Gutachter mit 1,3 beziehungsweise 1,4 Prozent einen spürbareren Anstieg der Wirtschaftsleistung.
Doch selbst diese Werte liegen im internationalen Vergleich im unteren Mittelfeld und sind nicht geeignet, die strukturellen Defizite der deutschen Volkswirtschaft auszugleichen.
Konjunkturpolitik als kurzfristiger Treiber
Einen entscheidenden Anteil an den positiven Vorhersagen hat die expansive Finanzpolitik der Bundesregierung.
Das im Frühjahr beschlossene Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro soll in den kommenden zwölf Jahren in Infrastruktur, Klimaschutz und Digitalisierung fließen.

Geplant sind Investitionen in marode Brücken, sanierungsbedürftige Bahnstrecken und Schulen, ebenso wie eine bessere Ausstattung von Kindertagesstätten und die Modernisierung der digitalen Verwaltung.
Um die Umsetzung zu beschleunigen, sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht werden.
Dieser staatliche Impuls wird die Binnenwirtschaft kurzfristig ankurbeln und damit auch Beschäftigung und Konsum stützen. Doch die Institute warnen davor, sich allein auf diesen Effekt zu verlassen. Die tieferliegenden Probleme seien mit einer konjunkturellen Starthilfe nicht zu beheben.
Strukturelle Schwächen als Wachstumsbremse
Die Gutachter zeichnen ein klares Bild der Herausforderungen: Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit nimmt seit Jahren ab. Hohe Energiepreise belasten insbesondere energieintensive Industrien. Gleichzeitig treiben steigende Lohnstückkosten die Produktionskosten in die Höhe. Im internationalen Vergleich wird es dadurch zunehmend schwieriger, mit Standorten in Asien oder Nordamerika mitzuhalten.
Hinzu kommt der Fachkräftemangel. Immer mehr Unternehmen berichten, dass sie offene Stellen nicht besetzen können – nicht nur im hochqualifizierten Bereich, sondern auch in der Industrie und im Handwerk. Dieser Mangel wirkt wie eine Bremse auf die gesamte Volkswirtschaft.
Ein weiteres Problem ist die schwächelnde Auslandsnachfrage. Die einstige Exportstärke der Bundesrepublik verliert an Dynamik. Ob Maschinenbau, Chemie oder Automobilindustrie – viele deutsche Kernbranchen spüren, dass ihre Produkte auf den Weltmärkten weniger gefragt sind. Gründe dafür sind neben den hohen Kosten auch geopolitische Spannungen, die zu neuen Handelshemmnissen und einer Abkehr von globalen Lieferketten führen.
Der „Herbst der Reformen“ – Mageres Wirtschaftswachstum
Vor diesem Hintergrund fordern die Wirtschaftsforschungsinstitute weitreichende Reformen, die über kurzfristige Konjunkturpakete hinausgehen. Sie sprechen vom „Herbst der Reformen“ und legen konkrete Vorschläge vor, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern.
Ein zentrales Thema ist die Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge. Angesichts einer alternden Gesellschaft steigen die Kosten für Rente und Gesundheitssystem kontinuierlich. Ohne Einsparungen drohen steigende Beiträge, die die Lohnnebenkosten weiter erhöhen und damit Beschäftigung unattraktiver machen. Die Institute plädieren deshalb für strukturelle Anpassungen, die langfristig finanzielle Stabilität schaffen.
Zudem sollen stärkere Arbeitsanreize geschaffen werden, insbesondere für Bezieher niedriger Einkommen. Viele Menschen in Teilzeit oder im Niedriglohnbereich hätten derzeit wenig Motivation, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, da zusätzliche Stunden nur begrenzt mehr Einkommen bringen. Steuerliche Entlastungen und Reformen im Transfersystem könnten hier Abhilfe schaffen.
Auch die Unternehmensregulierung steht in der Kritik. Deutschland dürfe seine Firmen nicht stärker belasten als andere Partnerländer. Besonders beim Klimaschutz sei darauf zu achten, dass ambitionierte Vorgaben nicht zu einem Wettbewerbsnachteil führen. Die Balance zwischen ökologischen Zielen und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sei entscheidend, um Abwanderung von Unternehmen zu verhindern.
Internationale Vergleiche und Lehren – Mageres Wirtschaftswachstum
Ein Blick ins Ausland zeigt, wie stark andere Industrienationen aktuell investieren – nicht nur in Infrastruktur, sondern auch in Forschung und Entwicklung. Länder wie die USA oder Südkorea setzen konsequent auf Innovation und Digitalisierung, während Deutschland vielerorts noch mit analogen Verwaltungsprozessen kämpft.
Die Gutachter mahnen, dass Deutschland dringend aufholen müsse. Ohne eine Stärkung des Innovationsstandorts drohe eine dauerhafte Wachstumsflaute. Die Herausforderungen reichen von der schleppenden Digitalisierung bis hin zu einem Bildungssystem, das in internationalen Vergleichsstudien zunehmend schlechter abschneidet.
Belastung durch geopolitische Unsicherheiten – Mageres Wirtschaftswachstum
Neben hausgemachten Problemen spielen auch externe Faktoren eine Rolle. Die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges hat gezeigt, wie abhängig Deutschland von internationalen Lieferketten und Rohstoffmärkten ist. Hohe Gas- und Strompreise wirken bis heute nach. Gleichzeitig belasten geopolitische Konflikte den Welthandel und erschweren die Planungssicherheit für Exporteure.
Die Institute betonen, dass Deutschland hier widerstandsfähiger werden müsse. Ein stärkerer Fokus auf Diversifizierung der Energiequellen, Ausbau erneuerbarer Energien und die Stärkung des europäischen Binnenmarktes könnten dazu beitragen, externe Schocks besser abzufedern.
Chancen und Risiken des Sondervermögens – Mageres Wirtschaftswachstum
Das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen ist ein historisch einmaliger Schritt. Es bietet die Chance, den Investitionsstau der vergangenen Jahrzehnte endlich aufzulösen. Sanierte Brücken, leistungsfähige Bahnstrecken, moderne Schulen und Kitas sowie eine funktionierende digitale Verwaltung könnten die Produktivität erheblich steigern.
Doch die Umsetzung ist entscheidend. Wenn die Mittel im bürokratischen Dickicht stecken bleiben oder ineffizient verteilt werden, verpufft die Wirkung. Auch die langfristige Verschuldung ist ein Risiko: Zwar sind die Zinsen aktuell vergleichsweise niedrig, doch die Schuldenlast könnte künftige Generationen belasten und den finanzpolitischen Spielraum einschränken.
Die Institute fordern deshalb, die zusätzlichen Investitionen eng an Effizienz- und Nutzenkriterien zu knüpfen. Jeder Euro müsse so eingesetzt werden, dass er die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit stärkt.
Reformdruck steigt – Mageres Wirtschaftswachstum
Der Ausblick der Wirtschaftsforscher ist klar: Ohne tiefgreifende Strukturreformen wird die deutsche Wirtschaft zwar in den kommenden Jahren etwas wachsen, aber nicht nachhaltig. Die aktuellen Prognosen verdeutlichen, dass Deutschland zwar die Talsohle hinter sich lässt, jedoch weiterhin auf wackeligen Beinen steht.
Die Politik ist gefordert, die Weichen für eine zukunftsfähige Wirtschaft zu stellen. Das bedeutet: Wettbewerbsfähigkeit sichern, Fachkräfte gewinnen, Innovation fördern und Bürokratie abbauen. Nur so lässt sich verhindern, dass die konjunkturelle Erholung erneut im Ansatz stecken bleibt.
Mageres Wirtschaftswachstum – Ein entscheidender Herbst für Deutschland
Deutschland steht an einem Wendepunkt. Die kommenden Monate und Jahre werden zeigen, ob es gelingt, aus der konjunkturellen Schwächephase herauszufinden und eine stabile Wachstumsbasis zu schaffen. Der „Herbst der Reformen“, den die Institute fordern, ist mehr als ein Schlagwort – er ist eine dringende Handlungsaufforderung.
Die Prognosen sind ein Weckruf: 0,2 Prozent Wachstum im Jahr 2025 sind zu wenig, um den Wohlstand zu sichern. Die Chance auf Besserung besteht, doch sie ist nur zu nutzen, wenn mutige Entscheidungen getroffen werden. Ein starker Staat, der Investitionen anstößt, und eine konsequente Reformpolitik, die die strukturellen Schwächen beseitigt, müssen Hand in Hand gehen.
Ob Deutschland diesen Kurs einschlägt, wird darüber entscheiden, ob das Land in einem global zunehmend rauen wirtschaftlichen Umfeld bestehen kann – oder ob es weiter ins Hintertreffen gerät.
Mageres Wirtschaftswachstum – Wir bleiben am Ball für Sie. BerlinMorgen.