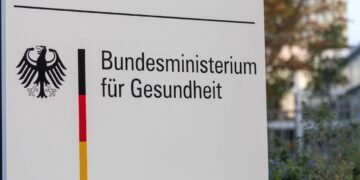Das Ermächtigungsgesetz von 1933 – Der Beginn der nationalsozialistischen Diktatur
Das Ende der Demokratie im Reichstag
Ermächtigungsgesetz von 1933 – Am 23. März 1933 wurde im Berliner Reichstag eines der folgenschwersten Gesetze der deutschen Geschichte verabschiedet:
das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“, besser bekannt als Ermächtigungsgesetz.
Dieses Gesetz legte die juristische Grundlage für die Zerstörung der Weimarer Demokratie und die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur unter Adolf Hitler.
Das Ermächtigungsgesetz gab der Regierung das Recht, Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments zu erlassen – sogar, wenn sie die Verfassung änderten.
Damit wurde die Gewaltenteilung aufgehoben und Hitler erhielt praktisch unbegrenzte Macht.
Hintergrund: Der Reichstagsbrand und die Machtergreifung Hitlers
Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 begannen die Nationalsozialisten sofort, ihre Macht auszubauen.
Am 27. Februar 1933 brannte der Reichstag – ein Ereignis, das die NSDAP als Vorwand nutzte, um politische Gegner zu verfolgen und die Demokratie auszuschalten.
Mit der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 wurden wesentliche Grundrechte außer Kraft gesetzt, darunter:
- Die Meinungsfreiheit
- Die Versammlungsfreiheit
- Der Schutz vor willkürlicher Verhaftung
Oppositionelle Politiker, insbesondere aus der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands), wurden verfolgt, inhaftiert oder ermordet.
Die Kommunisten wurden sogar aus dem Reichstag ausgeschlossen – ein entscheidender Schritt, um eine Zweidrittelmehrheit für das Ermächtigungsgesetz zu ermöglichen.
Ermächtigungsgesetz von 1933 – Die Abstimmung im Reichstag – Einschüchterung und Terror
Die Reichstagssitzung am 23. März 1933 fand in einer Atmosphäre der Angst und Gewalt statt.
Die Nationalsozialisten hatten die Sturmabteilung (SA) vor dem Reichstag aufmarschieren lassen, um die Abgeordneten einzuschüchtern.
- Die KPD-Abgeordneten waren bereits verhaftet oder ins Exil geflohen.
- Die Zentrum-Partei und andere bürgerliche Parteien standen unter massivem Druck, dem Gesetz zuzustimmen.
- Die SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) war die einzige Fraktion, die mutig dagegen stimmte – trotz der Drohungen und Gewalt der Nationalsozialisten.

Am Ende wurde das Ermächtigungsgesetz mit 444 Ja-Stimmen gegen 94 Nein-Stimmen (von der SPD) verabschiedet.
Damit hatten sich die Nationalsozialisten de facto eine rechtliche Diktatur geschaffen.
Die Folgen – Ermächtigungsgesetz von 1933
Mit dem Ermächtigungsgesetz konnten Hitler und seine Regierung Gesetze ohne parlamentarische Kontrolle erlassen.
In den folgenden Monaten und Jahren nutzten die Nationalsozialisten diese Macht, um ihre totalitäre Herrschaft zu festigen:
- Verbot aller politischen Parteien außer der NSDAP (Juli 1933).
- Zerschlagung der Gewerkschaften und Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Organisationen.
- Aufbau der Gestapo (Geheime Staatspolizei) als Instrument der politischen Verfolgung.
- Verfolgung und Ermordung von Gegnern, insbesondere Kommunisten, Sozialdemokraten, Juden und andere als „Feinde des Volkes“ bezeichnete Gruppen.
- Etablierung eines Einparteienstaates – Hitler war nun nicht nur Regierungschef, sondern faktisch alleiniger Gesetzgeber.
Das Ermächtigungsgesetz wurde bis zum Ende des Dritten Reiches 1945 immer wieder verlängert und blieb die Grundlage für Hitlers Willkürherrschaft.
Der Widerstand der SPD – Eine einsame Stimme gegen die Diktatur
Die SPD war die einzige Partei, die offen gegen das Ermächtigungsgesetz stimmte.
Ihr Vorsitzender Otto Wels hielt eine denkwürdige Rede, in der er erklärte:
„Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht!“
Doch sein Mut konnte den Lauf der Geschichte nicht aufhalten.
Nach der Abstimmung wurde die SPD als letzte Oppositionspartei verboten, ihre Abgeordneten verfolgt und inhaftiert.
Der entscheidende Schritt zur totalitären Herrschaft – Ermächtigungsgesetz von 1933
Mit dem Ermächtigungsgesetz beseitigte Hitler die letzten demokratischen Strukturen der Weimarer Republik und verwandelte Deutschland in eine totalitäre Diktatur.
Die Folgen waren verheerend: Unterdrückung, Verfolgung, Krieg und schließlich der Holocaust.
Die Ereignisse des 23. März 1933 zeigen, wie gefährlich es ist, demokratische Institutionen zu schwächen.
Sie sind eine Mahnung an zukünftige Generationen, sich gegen autoritäre Tendenzen zu wehren und die Werte der Demokratie zu verteidigen.
Ermächtigungsgesetz von 1933 – Wir bleiben am Ball für Sie. BerlinMorgen.