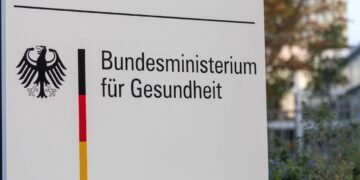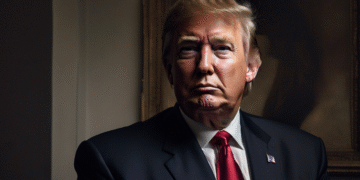Resolution des Menschenrechtsrats: Wie die UN über die Gräuel im Sudan diskutieren
Ein Land im Schatten: Der vergessene Krieg im Sudan
Sudan Völkermord – Während die Weltöffentlichkeit ihren Blick auf die Ukraine, den Nahen Osten oder geopolitische Rivalitäten zwischen Großmächten richtet, spielt sich im Sudan eine der schlimmsten humanitären Katastrophen unserer Zeit ab. Mord, Folter, Massenvergewaltigungen, ethnische Säuberungen – die Liste der Gräueltaten ist lang. Allein in der Großstadt Al-Faschir, im Westen des Landes, berichten Überlebende von Szenen, die an die dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte erinnern.
Rund 150.000 Menschen sitzen dort fest, umzingelt von der Miliz der Rapid Support Forces (RSF), die seit Monaten Jagd auf Zivilisten macht. Die Vereinten Nationen sprechen von systematischer Gewalt gegen die nicht-arabische Bevölkerung – ein gezielter Vernichtungsfeldzug, der an den Völkermord in Ruanda erinnert. Nun hat sich der UN-Menschenrechtsrat in Genf zu einer Dringlichkeitssitzung versammelt, um über die Lage zu beraten.
Die Dringlichkeitssitzung: Worte statt Waffen
Mehr als 40 Staaten beteiligten sich an der Sitzung. Der Tenor war eindeutig: Die internationale Gemeinschaft verurteilte die Gewalt im Sudan in schärfster Form. Die verabschiedete Resolution des Menschenrechtsrats fordert eine umfassende Untersuchung der Vorgänge und dokumentiert zugleich die tiefe Ratlosigkeit der Weltgemeinschaft.
Die Resolution ruft dazu auf, alle Verantwortlichen für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu identifizieren und Beweise für eine mögliche spätere strafrechtliche Verfolgung – etwa vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) – zu sichern. Sie verurteilt außerdem jede Form „externer Einmischung“, die den Konflikt anheizt – eine Formulierung, die sich gegen mehrere Länder richtet, die indirekt oder direkt in den Konflikt verwickelt sind.
Doch nicht alle Mitglieder des Rates stimmten zu. China, der Sudan und mehrere weitere Staaten lehnten die Einrichtung einer Untersuchungskommission ab. Peking argumentierte, es handle sich um eine „interne Angelegenheit“, in die internationale Organe nicht eingreifen dürften – ein altbekanntes Narrativ autoritärer Regierungen, die Souveränität als Schutzschild gegen Verantwortung nutzen.
Der UN-Menschenrechtsrat: Symbol ohne Zähne?
Der Rat mit seinen 47 Mitgliedsstaaten hat keine Machtmittel, um Staaten oder Milizen direkt zur Rechenschaft zu ziehen. Seine Stärke liegt im Aufdecken, Dokumentieren und Publizieren. In vielen Fällen bildeten Berichte des Rates die Grundlage späterer Verfahren – etwa in Syrien, Myanmar oder Libyen. Doch im Sudan bleibt das Dilemma bestehen: Wer soll handeln, wenn diejenigen, die handeln könnten, schweigen?
Die Resolution ist daher mehr als ein juristisches Instrument – sie ist ein moralisches Statement. Sie soll Druck aufbauen, internationale Aufmerksamkeit schaffen und der Welt zeigen, dass die Verbrechen im Sudan nicht unbemerkt bleiben. Dennoch fragen sich viele Beobachter, ob das genügt. Denn während in Genf debattiert wird, sterben im Sudan täglich Menschen.
Al-Faschir: Eine Stadt als Symbol des Grauens
Die Berichte aus Al-Faschir sind kaum zu ertragen. Nach eineinhalb Jahren der Belagerung fiel die Stadt Ende Oktober in die Hände der RSF. Augenzeugen berichten, dass Kämpfer systematisch Häuser durchsuchten, Männer erschossen, Frauen verschleppt und Kinder missbrauchten.

Ganze Stadtviertel wurden niedergebrannt. Die Fluchtwege sind blockiert – wer versucht zu entkommen, riskiert den Tod.
Eine Vertreterin der unabhängigen UN-Kommission für den Sudan, Mona Rishwani, schilderte vor dem Rat die grausame Realität: Die Täter verstecken ihre Verbrechen nicht – sie filmen sie, stellen die Videos ins Netz und feiern ihre Brutalität. Gewalt als Propaganda, Folter als Machtdemonstration.
Humanitäre Isolation: Warum die UN nicht helfen kann
Die Vereinten Nationen haben keinen Zugang zu Al-Faschir. Ihre Hilfsorganisationen sitzen in der Region Tawila, etwa 60 Kilometer entfernt, wo mehr als 80.000 Geflüchtete Schutz suchen. Doch selbst dort ist die Versorgung prekär. Konvois mit Nahrung, Medikamenten und Wasser kommen kaum durch. Ohne militärische Präsenz oder Sicherheitsgarantien bleibt humanitäre Hilfe weitgehend blockiert.
Das Deutsche Rote Kreuz und andere Organisationen werfen der internationalen Gemeinschaft Untätigkeit vor. Der Konflikt finde kaum Beachtung, die Spendenbereitschaft sei gering, und politischer Druck auf die Kriegsparteien fehle nahezu völlig. So sterben Menschen – nicht nur durch Kugeln, sondern auch durch Hunger, Durst und Krankheiten.
Das Schweigen der Weltgemeinschaft
UN-Hochkommissar Volker Türk fand in Genf ungewöhnlich scharfe Worte. Er sprach von einem „kollektiven Versagen“. Trotz frühzeitiger Warnungen habe die Welt weggeschaut. Bilder von Blutlachen in den Straßen Al-Fashirs seien aus dem Weltraum sichtbar, doch die moralischen Flecken auf dem Gewissen der Staaten seien es nicht minder.
Türk machte zudem auf die ökonomischen Interessen aufmerksam, die hinter dem Krieg stehen. Der Sudan sei reich an Rohstoffen, Gold, Öl und seltenen Erden – ein Magnet für ausländische Akteure. Der Konflikt sei längst zu einem Stellvertreterkrieg geworden, angeheizt von regionalen und globalen Mächten, die von Chaos und Instabilität profitieren. Die Vereinten Nationen rufen daher dazu auf, gezielt gegen jene Personen und Unternehmen vorzugehen, die Waffen liefern, Milizen finanzieren oder illegalen Handel ermöglichen.
Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch sehen in der Resolution immerhin einen Hoffnungsschimmer: Sie könne den Weg für künftige Strafverfahren ebnen, Verantwortliche namentlich benennen und politischen Druck erzeugen. Doch sie warnen zugleich: Ohne Konsequenzen bleibt jedes Dokument nur Papier.
Wie alles begann: Vom Militärputsch zum Bürgerkrieg
Um die Tragödie im Sudan zu verstehen, muss man in das Jahr 2023 zurückblicken. Damals begann die RSF, eine paramilitärische Truppe unter Führung von Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, mit Angriffen auf Armee und Zivilisten. Der Auslöser: die Weigerung der RSF, in die reguläre Armee integriert zu werden. Damit eskalierte ein schwelender Machtkampf zwischen Hemeti und dem De-facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan.
Beide waren einst Verbündete – gemeinsam stürzten sie 2019 den langjährigen Diktator Omar al-Baschir. Doch aus Partnern wurden Rivalen, und ihr Streit verwandelte das Land in ein Schlachtfeld. Heute kontrolliert die RSF weite Teile des Westens, darunter fast ganz Darfur und Teile von Kordofan. Die reguläre Armee hält den Osten, darunter die Hauptstadt Khartum, doch der Krieg hat jede Struktur zerstört.
Ethnische Säuberungen: Alte Wunden, neue Grausamkeit
Die RSF ist die Nachfolgeorganisation der berüchtigten Janjaweed-Milizen, die bereits in den 2000er Jahren in Darfur Völkermord verübten. Damals töteten sie Hunderttausende Menschen, vor allem aus nicht-arabischen Volksgruppen. Heute setzt sich dieses Muster fort. Die RSF richtet ihre Angriffe gezielt gegen bestimmte ethnische Gruppen – Taktiken, die von UN-Beobachtern als Völkermordhandlungen eingestuft werden könnten.
Das sudanesische Ärztenetzwerk spricht offen von „Genozid“. Selbst UNICEF-Vertreter vergleichen die Situation mit Ruanda: ein ethnisch aufgeladener Bürgerkrieg, der außer Kontrolle geraten ist, während die Welt zusieht.
Die humanitäre Bilanz: Eine ganze Nation im Überlebenskampf
Der Sudan erlebt derzeit die größte humanitäre Krise der Welt. Über 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht, 26 Millionen hungern. Ganze Landstriche sind entvölkert, Krankenhäuser zerstört, Schulen geschlossen. Die Wirtschaft liegt in Trümmern, Geld verliert rasant an Wert, und selbst Hilfsgüter erreichen oft nur einen Bruchteil der Bedürftigen.
Beiden Konfliktparteien – Armee und RSF – werden Kriegsverbrechen vorgeworfen: Massaker, Plünderungen, sexualisierte Gewalt, Einsatz von Kindersoldaten. Beide Seiten weisen die Vorwürfe zurück. Doch die Beweise mehren sich. Satellitenbilder zeigen verbrannte Dörfer, Massengräber und zerstörte Wasserstellen. Internationale Beobachter sprechen von einer „Kultur der Straflosigkeit“, die seit Jahrzehnten in Sudan herrscht.
Die Rolle externer Akteure: Interessen statt Hilfe
Kaum ein afrikanisches Land ist so sehr in internationale Interessen verstrickt wie der Sudan. Der Niger, der Kongo oder Mali stehen oft im Fokus, doch im Sudan treffen gleich mehrere geopolitische Linien aufeinander.
- Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sollen laut UN-Berichten Waffen an die RSF liefern – meist über Umwege durch Libyen oder den Tschad.
- Ägypten unterstützt die reguläre Armee, um islamistische Gruppierungen in der Region einzudämmen.
- Russland ist über die Söldnergruppe Wagner indirekt präsent und interessiert an Goldminen und Hafenrechten am Roten Meer.
- China hält sich offiziell neutral, sichert sich aber Rohstoffzugänge und blockiert UN-Initiativen, die Sanktionen vorsehen.
So ist der Krieg längst Teil eines globalen Machtspiels. Die Leidtragenden sind Millionen unschuldiger Zivilisten.
Vermittlungsversuche: Waffenruhe oder Illusion?
Derzeit versuchen Vermittler aus den USA, den VAE, Saudi-Arabien und Ägypten, eine dreimonatige Waffenruhe zu verhandeln. Auch eine längere neunmonatige Verhandlungsphase steht im Raum. Anfang November signalisierte die RSF ihre Zustimmung – die Armee hingegen zögert. Der Grund: Misstrauen gegenüber den Vermittlern, insbesondere gegenüber den VAE, die als Unterstützer der RSF gelten.
Die Hoffnung auf Frieden ist daher gering. Frühere Waffenstillstände hielten kaum länger als einige Tage. Ohne verbindliche Garantien, internationale Überwachung und klare Sanktionen gegen Verstöße droht jede Vereinbarung, zur bloßen Illusion zu werden.
Stimmen aus der Region: Zwischen Angst und Resignation
Für die Menschen im Sudan ist der Konflikt längst Alltag geworden. Viele haben alles verloren – Familien, Häuser, Hoffnung. Schulen dienen als Notunterkünfte, Brunnen sind vergiftet, Märkte geplündert. Wer sich zu äußern wagt, riskiert Folter oder Tod.
Hilfsorganisationen berichten von ganzen Dörfern, in denen keine Männer mehr leben. Frauen und Kinder schlagen sich durch, oft unter Zwangsarbeit oder in improvisierten Lagern. Die Traumata reichen tief. Viele sehen keinen Sinn mehr in Appellen oder Resolutionen – sie wollen konkrete Hilfe, nicht diplomatische Floskeln.
Die Rolle Europas: Abwesend oder ohnmächtig?
Europa spielt in diesem Konflikt eine marginale Rolle. Während die EU über Grenzschutz, Migration und Energieversorgung debattiert, bleibt Afrika weitgehend Randthema. Zwar hat Brüssel humanitäre Hilfen zugesagt, doch die Summen sind minimal im Vergleich zu den Bedürfnissen. Zudem fließen sie oft nicht in die betroffenen Gebiete, weil der Zugang fehlt.
Deutsche Politiker betonen zwar regelmäßig die Bedeutung von Menschenrechten, doch konkrete Taten bleiben aus. Die Frage drängt sich auf: Wie glaubwürdig ist ein westliches Wertebekenntnis, wenn es beim ersten geopolitischen Risiko verstummt?
Zwischenbericht der UN: Hoffnung auf Gerechtigkeit?
Trotz aller Hindernisse versucht die UN-Kommission, Beweise zu sichern. Digitale Forensik, Satellitendaten und Augenzeugenberichte werden gesammelt, um die Verantwortlichen irgendwann vor Gericht zu bringen. Schon jetzt zeichnet sich ein Muster ab, das in früheren Konflikten – etwa in Darfur – als Grundlage für Anklagen diente.
Doch ohne politischen Willen bleiben die Akten geschlossen. Der Internationale Strafgerichtshof hat zwar theoretisch Zuständigkeit, doch weder der Sudan noch einige der wichtigsten Unterstützerstaaten der RSF erkennen seine Autorität an.
Moralische Verantwortung: Eine Frage der Konsequenz
Was bleibt, ist die moralische Verantwortung der Weltgemeinschaft. Der Konflikt im Sudan ist mehr als ein afrikanisches Drama. Er ist ein Spiegel globaler Doppelmoral. Wer in Genf Resolutionen beschließt, aber keine Konsequenzen zieht, verliert Glaubwürdigkeit. Der Schutz der Menschenrechte darf nicht von strategischen Interessen abhängen.
Volker Türk fasste die Lage sinngemäß so zusammen: Der Fleck auf der Weste der internationalen Gemeinschaft mag unsichtbar sein – aber er wird bleiben, solange Menschen in Al-Faschir, Darfur oder Kordofan um ihr Leben flehen und niemand antwortet.
Ausblick: Zwischen Schweigen und Aufbruch
Die Resolution des UN-Menschenrechtsrats ist ein Schritt – aber ein kleiner. Sie dokumentiert, mahnt und erinnert. Doch sie ersetzt kein Handeln. Der Sudan braucht dringend einen internationalen Schutzmechanismus, Sanktionen gegen Waffenlieferanten, humanitäre Korridore und die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit.
Solange das ausbleibt, bleibt der Krieg ein offenes Wundmal auf der Landkarte Afrikas – und ein Symbol dafür, wie still die Welt werden kann, wenn kein Öl, kein Gas und keine Schlagzeilen zu holen sind.
Die folgenden Länder haben sich bei der Sitzung des UN Human Rights Council am 14. November 2025 von den Abschnitten über die Einrichtung der Untersuchungskommission (Fact-Finding Mission) distanziert oder diese abgelehnt:
- Sudan
- China
- Ethiopia
- Cuba
Wenn Sie möchten, kann ich prüfen, ob noch weitere Länder (z. B. durch Enthaltungen oder Schwächung der Paragraphen) dokumentiert sind.
Sudan Völkermord – Wir bleiben am Ball für Sie. BerlinMorgen.
Quelle ISHR
Foto EnginKorkmaz/ adobe.com