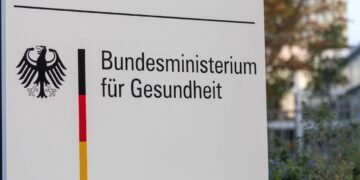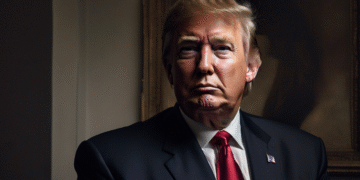Grundsteuer: Kommunen erhöhen Einnahmen – Bürger fürchten Mehrbelastung
Einnahmen wachsen schon vor der Reform
Grundsteuer Mehrbelastung – Die Städte und Gemeinden in Deutschland haben im Jahr 2024 mehr Grundsteuer eingenommen – noch bevor die große Reform zum 1. Januar 2025 in Kraft trat.
Nach aktuellen Zahlen summierten sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B, die auf bebaute und unbebaute Grundstücke erhoben wird, auf 15,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Anders sah es bei der Grundsteuer A aus, die für land- und forstwirtschaftliche Flächen gilt:
Hier gingen die Einnahmen leicht um 2,9 Prozent auf 0,4 Milliarden Euro zurück.
Zentrale Einnahmequelle für Städte und Gemeinden
Die Grundsteuer zählt zu den bedeutendsten Einnahmequellen der Kommunen.
Mit ihr finanzieren Städte und Gemeinden öffentliche Aufgaben wie die Instandhaltung von Straßen, Schulen oder Grünflächen.
Für den Bund der Steuerzahler kommt es daher nicht überraschend, dass viele Kommunen bereits im Vorfeld der Reform auf steigende Einnahmen setzen.
„Aufkommensneutralität“ bleibt ein Streitpunkt
Die Bundesregierung hatte den Bürgerinnen und Bürgern ursprünglich zugesichert, dass die Reform „aufkommensneutral“ umgesetzt werde.
Das bedeutet: Die Gesamteinnahmen einer Kommune sollten trotz neuer Berechnungsgrundlagen nicht höher ausfallen als zuvor.

Doch schon jetzt gibt es Zweifel, ob dieses Versprechen eingehalten wird.
Zwar sollen Belastungsverschiebungen zwischen verschiedenen Eigentümern unausweichlich sein – im Durchschnitt sollte die Steuerlast jedoch gleich bleiben. Verbände und Steuerexperten warnen allerdings, dass in vielen Kommunen deutliche Steuererhöhungen bevorstehen.
Niedersachsen im Fokus: Hebesätze steigen
Ein Beispiel liefert Niedersachsen.
Dort haben nach Angaben von Verbänden wie dem Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen rund ein Drittel der Kommunen Hebesätze beschlossen, die oberhalb der aufkommensneutralen Marke liegen.
Damit steigen die Steuerlasten für Haus- und Grundstückseigentümer ebenso wie für Mieter.
Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ist der sogenannte Hebesatz.
Jede Gemeinde legt diesen Faktor selbst fest. Multipliziert mit dem vom Finanzamt ermittelten Grundsteuermessbetrag ergibt sich der Betrag, den Eigentümer künftig zahlen müssen.
Neubewertung aller Grundstücke abgeschlossen
Grundlage für die Reform ist die Neubewertung sämtlicher Grundstücke in Deutschland.
Die Finanzämter haben dafür Grundstücksgröße, Lage und Bodenrichtwert herangezogen.
Aus diesen Angaben wurde der Grundsteuerwert errechnet, der mit der Steuermesszahl multipliziert den Grundsteuermessbetrag ergibt. Erst die Gemeinden legen mit ihrem Hebesatz die endgültige Steuer fest.
Einspruchsmöglichkeiten begrenzt – Grundsteuer Mehrbelastung
Viele Eigentümer überlegen nun, ob sie gegen höhere Grundsteuerbescheide vorgehen können.
Während Einsprüche gegen den Hebesatz aussichtslos sind, besteht die Möglichkeit, gegen die Bewertung des Grundstücks durch das Finanzamt Einspruch einzulegen.
Die Frist beträgt einen Monat. In der Praxis sind die meisten Grundstücke jedoch bereits bewertet, sodass die Erfolgsaussichten überschaubar bleiben.
Belastung steigt vielerorts – Grundsteuer Mehrbelastung
Fakt ist: Auch wenn die Reform offiziell keine höheren Gesamteinnahmen bringen sollte, kassieren zahlreiche Kommunen schon jetzt deutlich mehr. Für viele Bürger bedeutet das eine spürbare Mehrbelastung.
Ob die Grundsteuerreform damit tatsächlich „aufkommensneutral“ bleibt, ist zweifelhaft – sicher ist jedoch, dass sie noch lange für Diskussionen sorgen wird.
Grundsteuer Mehrbelastung – Wir bleiben am Ball für Sie. BerlinMorgen.